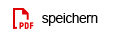Der größte Energiespeicher Herrschings liegt direkt vor der Haustür: Der Ammersee könnte uns im nächsten Jahrzehnt mollig warme Wohnungen bescheren. Diese Vision breitete der Tutzinger Dr. Marco Lorenz vor den Zuhörern des Arbeitskreises Energie in Herrsching aus. In Tutzing hat man schon einmal vorgedacht und prüft jetzt in einer Machbarkeitsstudie, ob der Starnberger See als Energiespender für ein Nahwärmenetz geeignet ist. „Beim Wasserwirtschaftsamt in Weilheim haben wir mit der Idee offene Türen eingerannt“, berichtete Lorenz in seinem Referat. Die Zuhörer – fast alle männlich und reiferen Alters – nahmen die Botschaft von der Wärmespende aus dem See sehr interessiert auf.

„Wenn’s die Schweizer können, dann müssten wir das doch auch können“, meinte der Grünen-Gemeinderat Gerd Mulert in seiner Begrüßung. In Luzern werden schon mehrere Gebäude durch eine See-Energie-Zentrale („Inseliquai“) mit Energie aus dem Vierwaldstättersee versorgt. Und in einem Pionierprojekt erschließt die EWL seit 2020 die Gemeinde Horw und die Stadt Kriens mit See-Energie. Was Luzern für die Eidgenossen ist, das könnte nun Tutzing für Bayern werden. Mit einem Solarpark haben die Power-Pioniere schon mal angefangen, jetzt tasten sie sich an eine Herkulesaufgabe heran: ein Nahwärmenetz mit Energie aus dem Starnberger See. Marco Lorenz, promovierter Maschinenbauer und Wirtschaftsingenieur, ist einer der Initiatoren der Bewegung „Tutzing klimaneutral 2035″. Das kesse Motto: „Unsere Initiative besteht aus Tutzinger Bürgerinnen und Bürgern, die nicht mehr abwarten wollen, sondern sich jetzt aktiv für Klimaneutralität in unserem schönen Ort einsetzen. Die Politik allein kann die Klimakrise nicht lösen. Deshalb packen wir mit an!“
Für das Projekt Seewärme haben die Tutzinger 6 Energieversorger angefragt und eine Machbarkeitsstudie angeschoben. Dass ein Gewässer für die Wärmegewinnung angezapft werden kann, das ist für die Wissenschaft ein alter Hut, nur ausprobiert hat’s in Deutschland noch niemand.

Und so funktioniert es in der Schweiz: Der Vierwaldstättersee birgt große Wärme- und Kältereserven. Einen kleinen Teil davon nutzen die Schweizer für eine umweltschonende Energieversorgung. See-Energie eignet sich für Klima-, Kühl- und Heizanlagen von Wohn- und Gewerbegebäuden. In einer Tiefe von etwa 30 bis 45 Metern beträgt die Wassertemperatur das ganze Jahr über konstant fünf Grad (im Starnberger und Ammersee wahrscheinlich 8 Grad). Eine Pumpe fördert das Seewasser in die See-Energie-Zentrale. Dort wird mittels Wärmetauscher die Energie an ein Rohrleitungsnetz übergeben. Das um rund drei Grad abgekühlte Wasser fließt zurück in den See. Für die Wärmeversorgung wird das Temperaturniveau mit Wärmepumpen erreicht. Wird im Winter viel geheizt, könnten Spitzenverbräuche mit zusätzlicher Gas-Unterstützung abgesichert werden. Die Wärme wird über das Leitungsnetz in die
Quartiere verteilt und mit einer Wärmeübergabestation an die Gebäudeheizung und Warmwasseraufbereitung übertragen.
Damit sich der ganze Aufwand aber lohnt, müssen die Hausbesitzer mitmachen: Um 6 Kilometer eines Warmwasserleitungssystems in Tutzing zu finanzieren, bräuchte man, so Marco Lorenz in seinem Vortrag, 260 Anschlüsse. Wichtig seien auch sogenannte „Ankerverbraucher“, die viel Energie abnehmen. Für das Wärmenetz allein rechnet Lorenz mit Kosten von etwa 8 Millionen Euro, für die Wärmezentrale würden etwa 5 Millionen anfallen. „13 Millionen Gesamtkosten sind eine übersichtliche Zahl“, meinte Lorenz dazu.
Der Starnberger See ist von seinem Volumen her der zweitgrößte See mit rund 3 Millionen Kubikmetern Wasser und deshalb auch ein unfassbar starker Energielieferant. „Wenn das Netz 24 Stunden lang bei voller Leistung Wärme abzapfen würde, würde man 171 Jahre brauchen, um den See um ein Grad abzukühlen“, sagte Lorenz und baut so schon einmal Gegenargumenten vor. Das etwa 8 Grad warme Wasser werde in etwa 30 Metern Tiefe entnommen, um eine gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten. 100 Meter von der Entnahmestelle entfernt werde das auf 3 Grad abgekühlte Wasser wieder in den See geleitet. So verhindere man zum Beispiel auch eine vertikale Strömung im See. Wasser-Umwälzungen würden vermutlich weder die Naturschützer noch die amtlichen Wasserwächter im Wasserwirtschaftsamt akzeptieren.
Die Wärmezentrale werde an 3 Entnahmestationen etwa 400 Kubikmeter Wasser pro Stunde entnehmen. Der Seewasserspiegel ändert sich deshalb aber nicht, weil das Wasser ja „naturbelassen“, aber um 5 Grad kälter, wieder zurückgeführt werde. Das ist ähnlich wie bei einem Atomkraftwerk, nur wird vom AKW kaltes Wasser aus dem Fluss oder Meer entnommen und dann deutlich wärmer wieder eingeleitet.
Lorenz berichtete in seinem Vortrag weiter, dass das Projekt in Tutzing auf großes Interesse beim Wasserwirtschaftsamt in Weilheim gestoßen sei. Die Tutzinger Projekt-Initiatoren hätten bei einem Termin in Weilheim mit einem sehr kleinen Kreis interessierter Fachleute gerechnet – „zur Präsentation haben sich dann aber sämtliche Abteilungsleiter eingefunden. Wir haben im Wasserwirtschaftsamt offene Türen eingerannt“.
Kein Wunder – in Deutschland gibt es bisher noch kein Seewärmenetz, ja, es gibt noch nicht einmal ein Genehmigungsverfahren für ein solches Projekt – Tutzing nimmt tatsächlich eine Pionierrolle ein. Aber nicht nur der amtliche Segen für ein Seewärmenetz steht noch in den Sternen – auch die organisatorische Basis für ein solch bedeutendes Kommunalunternehmen muss sorgfältig geplant werden. Für Marco Lorenz von der Tutzinger Klimawende kommt aber wohl nur ein genossenschaftliches Format mit mehrheitlicher Beteiligung der Bürgerschaft und der Gemeinde in Frage. Das, so Lorenz, sei auch kein Problem, weil alle 6 Energieanbieter, die sich für die Realisierung eines Seewärmenetzes interessieren, hätten mit einem genossenschaftlichen Konstrukt kein Problem. Die politische Gemeinde würde sich mit 5 Prozent an dem Unternehmen beteiligen, im Boot wäre neben den Bürger-Genossen natürlich auch der Energieversorger. „Alle 6 Interessenten haben in Aussicht gestellt, dass sie ihre Bücher für die Beteiligten öffnen würden“, erzählte Lorenz. „Open books“ nennt man dieses transparente Geschäftsmodell. Und ein Anbieter stellt sogar in Aussicht, die Wärmepumpen zu spendieren.
Das Tutzinger Modell scheint also viel Fantasie freigesetzt zu haben – alle sind wegen dieses Pilotprojekts „heiß wie Frittenfett“ – um mal ein umgangssprachliches Fazit zu ziehen.