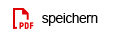Auch wenn der Himmel öfter mal den Kaltwasserhahn aufgedreht hat – die Durchschnittstemperatur des Ammersees lag in diesem Sommer bei wohltemperierten 21,4 Grad. Im August erwärmte sich der See sogar bis auf 26,3 Grad. Das ist schön für die Warmduscher unter uns. Für die Renken und die Seeforellen aber sind das sehr schlechte Nachrichten. In jedem Jahrzehnt wird der See um etwa 0,5 Grad wärmer. herrsching.online hat bei den Experten Karlheinz Daamen und Robert Kapa vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim nachgefragt, was das für die Gewässerqualität bedeutet.
herrsching.online: In der letzten Woche gab es verblüffende Temperaturschwankungen im Ammersee. Anfang der Woche lag die Temperatur bei einer Nordwindströmung bei 20 bis 21 Grad, am Mittwoch maßen Badegäste aber schon wieder bis zu 25 Grad. Der Wind hatte gedreht und kam eher aus westlichen Richtungen. Welche Komponenten beeinflussen die Wassertemperaturen stärker: Die Tages- und Nachttemperaturen, Windrichtungen oder die Strömungen?

Daamen: Das ist hängt sicher auch immer von dem konkreten Ort ab, der betrachtet wird. Für den Ammersee und unsere Messstellen können wir vom Wasserwirtschaftsamt aber sagen, dass es einen starken Zusammenhang zwischen Luft- und Wassertemperatur gibt. Das Wasser reagiert deutlich gedämpfter und mit einer zeitlichen Verzögerung auf die Änderungen der Lufttemperatur. Dementsprechend spiegelt sich auch der Tagesgang der Lufttemperatur mit geringerer Amplitude und zeitlich verschoben in der Wassertemperatur wider. Zum Einfluss der Windrichtung und Strömungen im Ammersee liegen uns keine Daten vor.
herrsching.online: Ist es richtig, dass die Wassertemperaturen am Ostufer bei östlichen Winden immer zwei bis vier Grad tiefer liegen als bei westlichen oder gar südlichen Windrichtungen?
Daamen: Wir messen die Wassertemperatur im Norden und im Süden, im Westen und Osten haben wir keine Messstellen. Temperaturunterschiede von bis zu zwei Grad Celsius in oberflächennaher Wassertiefe haben wir aber auch schon festgestellt zwischen unserer Messstation in Stegen am Nordufer und der Ammerseeboje, die im freien Wasser über der tiefsten Stelle im See im Süden misst. In der Regel liegen die Messwerte aber sehr eng beieinander. Eine Abhängigkeit von der Windrichtung untersuchen wir dabei nicht.
herrsching.online: Welche physikalischen Vorgänge setzen die Winde im Seewasser in Gang?
Daamen: Der Wind erzeugt Wellen, die am Ammersee schon eine beachtliche Größe erreichen können. Je stärker der Wind weht, desto stärker durchmischen sich die oberflächennahen Wasserschichten. Dadurch kann schwereres, kälteres Wasser an die Oberfläche gelangen. Mit der Zeit „sortiert“ sich das Wasser aber wieder entsprechend der Schwerkraft.
herrsching.online: Wie hoch ist im Sommer die durchschnittliche Wassertemperatur?
Daamen: Die mittlere Wassertemperatur an der Messstelle Stegen betrug von Juni bis Mitte August etwa 21,4 Grad Celsius.
herrsching.online: Was waren die Spitzenwerte und die Tiefstwerte von Mai bis Mitte August?
Daamen: Die Tiefstwerte im Mai betrugen 8,0 Grad Celsius, im Juni 16,0 Grad Celsius, im August bis zum 20. August 18,2 Grad Celsius.
herrsching.online: Und die Spitzenwerte?
Daamen: Als Spitzenwerte haben wir im Mai 17,8 Grad Celsius, Juni 24,9 Grad Celsius und im August bis zum 20. August 26,3 Grad Celsius gemessen.
Robert Kapa ist beim Wasserwirtschaftsamt Weilheim für das Monitoring im Bereich Chemie und Biologie zuständig. Er beschäftigt sich auch mit den Auswirkungen höherer Wassertemperaturen auf die Gewässerökologie und die Binnenfischerei.
herrsching.online: Herr Kapa, zeichnet sich ab, dass die Wassertemperatur in den letzten Jahren gestiegen ist?
Kapa: Eine Auswertung des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin zu Langzeitdaten aus 46 deutschen Seen zeigt, dass die Oberflächentemperatur der Seen, also im Mittel aller Seen, in den letzten 30 Jahren etwa 0,5 Grad Celsius pro Jahrzehnt gestiegen ist. Die Wassertemperatur der Seen in der Tiefe blieb hingegen annähernd konstant.Damit ist die Wassertemperatur an der Oberfläche stärker gestiegen als die Lufttemperatur. Im Vergleich ist die Lufttemperatur im Zeitraum von 1990 bis 2020 pro Dekade nur um 0,43 Grad Celsius pro Jahrzehnt gestiegen.
herrsching.online: Welche Folgen hat das für die Flora und Fauna im Wasser?
Kapa: Was die Seen als Lebensraum für Pflanzen und Tiere angeht, wirken sich die klimabedingt steigenden Wasserstemperaturen negativ auf die Biodiversität der Seen aus. Insbesondere in den Uferbereichen und in der sich stärker erwärmenden Oberflächenschicht der Seen profitieren wärmeliebende und wärmetolerante Arten gegenüber solchen, die eher wärmeempfindlich sind. Hier kommt es also zu einer Verschiebung des heimischen Artengefüges.
herrsching.online: Welche eingewanderten Pflanzen und Tierarten breiten sich stark aus?
Kapa: Zum Beispiel unter den Pflanzen das Große Nixenkraut, das sich etwa seit Beginn der 80er-Jahre zunehmend in den bayerischen Voralpenseen ausgebreitet hat und heute ausgedehnte Massenbestände in zuvor durch viel artenreichere Pfanzenbestände gekennzeichneten Bereichen entwickelt. Vielen Schwimmern ist das unangenehm stachelige Kraut auch im Ammersee nur zu gut bekannt. Hinzu kommt, dass zunehmend Organismen aus wärmeren Regionen in die bayerischen Seen einzuwandern drohen, insbesondere aus dem Schwarzmeergebiet, die die heimischen Arten verdrängen können. Beispiele dafür wären der Höckerflohkrebs, der im Starnberger See den heimischen Bachflohkrebs schon weitgehend verdrängt hat oder die Dreikantmuschel, die auch im Ammersee Massenbestände entwickeln konnte. Als weitaus gefährlichere Art gilt zudem die ähnliche Quaggamuschel, die bereits im Bodensee für erhebliche ökologische Probleme sorgt.
herrsching.online: Welche Fische sind Profiteure der Erwärmung, welche Arten leiden darunter?
Kapa: Auswirkungen hat die Erwärmung auf das ganze Nahrungsnetz, an deren Ende im Wasser letztlich auch die Fische stehen. Aber auch unter den Fischen finden sich Profiteure der Erwärmung, wie etwa heimische karpfenartige Fische, aber auch eingewanderte Arten wie der Blaubandbärbling oder der Sonnenbarsch.
Zu den Verlierern zählen dagegen die wärmeempfindlichen Salmoniden, die Lachsartigen, zu denen unter anderen die Seeforelle und im weiteren Sinne auch die Renken zählen. Allerdings können diese Arten bei zu hohen Sommertemperaturen an der Oberfläche insbesondere in den großen und tiefen Seen, also auch im Ammersee, noch gut in kühlere Tiefenbereiche ausweichen.
1herrsching.online: Könnte durch die Erwärmung auch die Sauerstoffversorgung im Wasser gefährdet sein?2
Kapa: Das Hauptproblem geht nicht direkt von den hohen Oberflächentemperaturen aus, sondern von der mit der Klimaerwärmung verbundenen – sich zunehmend verlängernden – Zeitdauer der stabilen Temperaturschichtung im Sommer. Dabei isoliert das in der Oberflächenschicht sich stark erwärmte Wasser das darunterliegende kühle Tiefenwasser vollständig von der atmosphärischen Durchmischung und damit von der Sauerstoffanreicherung. Je länger diese Isolation in den Herbst hinein andauert, desto mehr Sauerstoff wird im Tiefenwasser aufgezehrt. Schließlich kann hier so viel Sauerstoff verbraucht werden, dass kritische Konzentrationen für sauerstoffbedürftige Organismen unterschritten werden können. Besonders negativ davon betroffen sind unter anderen die Renken, die im Sommer im kühlen Tiefenwasser ihren Rückzugsraum haben.
Mit der längeren jährlichen Schichtungsdauer besteht also die Gefahr, dass vor allem im Herbst größere Bereiche des Tiefenwassers sauerstofffrei und lebensfeindlich für höhere Organismen wie Fische und Makrozoobenthos werden.
Auch die chemischen Verhältnisse in den Seensedimenten können sich dadurch negativ verändern und Prozesse der Eutrophierung durch Nährstoffrücklösungen vorantreiben, die die Wasserqualität zunehmend beeinträchtigen. Mit der damit verbundenen Düngung der gesamten Wassersäule kann es zu verstärkten Algenblüten kommen, die wiederum durch Abbauprozesse zu einem sich weiter verstärkendem Sauerstoffverbrauch führen. Sichtbarer und für den Menschen sehr unangenehmer Effekt sind zum Beispiel die verstärkten Blaualgenblüten, die sich bis in den Spätherbst hineinziehen. Sie führen dann auch zu Badeverboten.
Der Klimawandel hat also auch eine eutrophierende Komponente (also eine übermäßige Anreicherung von Nährstoffen; Red.). Um die damit verbundene Problematik abzumildern, werden Maßnahmen zur weiteren Reduzierung von Nährstoffeinträgen in die Gewässer, zum Beispiel durch die Landwirtschaft, zunehmend bedeutender.