Die Veranstaltung wurde vorher politisch aufgeladen, dabei ging’s so harmonisch zu wie im Gartenbauverein: Genossenschaften, stellte der Münchner Spezialist für gemeinschaftliches Bauen, Christian Stupka, klar, hätten nichts mit „Sozis“ zu tun. Alle Parteien könnten sich hinter dem Konzept versammeln: Die SPD sei für kollektives Wohneigentum, weil es solidarisch Wohnraum schaffe, die CSU sei dafür, weil Genossenschaften gut für junge Familien seien, sogar die FDP wolle diese Art der Bauträgerschaft, weil sie auf Eigeninitiative beruhe. Dass die Frage „Bezahlbares Wohnen, aber wie?“ im evangelischen Gemeindehaus nur von Grünen, BGH und FDP gestellt wurde, war für Beobachter verstörend – SPD und CSU mochten nicht als Veranstalter auftreten. Allerdings saßen SPD-Gemeinderat Wolfgang Schneider und CSU-Rat Michael Bischeltsrieder im Publikum.
• Warum Einheimischen-Modelle heute nicht mehr funktionieren
• Tiefgaragen sind Kostentreiber
• Ist die Autostellplatzsatzung in Herrsching noch zeitgemäß?
• Seit 30 Jahren gibt es in Herrsching keinen sozialen Wohnungsbau mehr
• Auch bei Genossenschaften kann man Einwohner Herrschings bevorzugen
• Grundstücke von der Gemeinde bekommt nicht mehr der Meistbietende, sondern der Bieter mit dem besten sozialen Konzept
• Genossenschaften verwalten sich selbst und funktionieren nach dem Demokratie-Prinzip
Pfarrer Ulrich Haberl streifte in seiner Begrüßung kurz die „Friktionen“, die der Veranstaltung vorausgingen. Dr. Traugott Schöfthaler vom Runden Tisch Herrsching kam gleich zum Thema und beklagte, dass seit 30 Jahren in Herrsching kein sozialer Wohnungsbau mehr stattgefunden habe. Ulrich Geßner, Mit-Moderator der Diskussion und Geschäftsführer des Wohnungsbau-Unternehmens IGEWO, kennt sich im genossenschaftlichen Wohnungsbau bestens aus und saß mit dem Referenten des Abends, Christian Stupka, im Dachverband der Münchner Genossenschaften GIMA.
Dreiecksgeschäft Gemeinde, Grundstücksbesitzer, Genossenschaft
„Alles, was ich heute erzähle, wird anderswo bereits erfolgreich praktiziert“, sagte Stupka, Mitbegründer der Pioniergenossenschaft WOGENO, die bereits 30 Jahre am Markt ist. Bestens kennt sich Stupka auch in Wörthsee aus, wo in einem Dreiecksgeschäft Gemeinde, Grundstücksbesitzer und Genossenschaft erfolgreich ein Mehr-Generationen-Projekt durchziehen (siehe dazu auch das Interview „Wie Mieter ihre eigenen Vermieter werden“).
Vor 30 Jahre seien Wissenschaftler davon ausgegangen, dass Deutschland wegen des demografischen Wandels auf 56 Millionen schrumpfe – kein Anlass also, größere Anstrengungen im Wohnungsbau zu unternehmen. Es kam bekanntlich anders: „Die Grundstückspreise gingen durch die Decke, kein normaler Mensch kann sich Neubaupreise von 10 000 Euro für den Quadratmeter umbauten Raumes leisten.“ So kamen die Wohnungsgenossenschaften ins Spiel, die ihr Gemeinschaftseigentum selbst verwalten und nach dem Demokratieprinzip funktionieren: Egal wie hoch die gezeichneten Anteile sind, jedes Mitglied hat das gleiche Stimmrecht.
Die Wohnungsbaugenossenschaften
• versorgen ihre Mitglieder mit dauerhaft günstigem Wohnraum
• verhindern individuellen Gewinn und entziehen Grund und Boden der Spekulation
• sind eine Solidargemeinschaft zwischen wohnenden und nicht wohnenden Mitgliedern
• wirtschaften gemeinsam.
Mitspielen muss natürlich die Kommune. Die Gemeinde kann Grundstücke mit der Verpflichtung an Bauherren abgeben, die sich verpflichten, die
• Mieten zu begrenzen,
• Wohnungen nicht in Eigentumswohnungen umwandeln und
• Wohnungen an einen berechtigten Personenkreis vergeben.
Kein Baurecht mehr ohne soziale Komponente
Das Grundstück, das die Gemeinde dann zu diesen Bedingungen verkauft beziehungsweise in Erbpacht vergibt, wird deutlich unter dem Marktpreis veräußert. Im Gegenzug bekommt die Gemeinde den dringend benötigten Mietwohnungsraum. Dieses Vorgehen verstoße übrigens nicht gegen Artikel 75 der Bayerischen Gemeindeordnung, so Stupka. Den Zuschlag für ein Grundstück – inzwischen meist in Erbpacht vergeben – bekomme nicht der Höchstbietende, sondern der Bieter mit dem besten und sozialsten Konzept. Und Baurecht bekomme ein Bauträger in München nur noch, wenn er mindestens 50 Prozent erschwingliche Wohnungen baue.
Einheimischen-Modelle mit Einfamilienhäusern seien nicht mehr zeitgemäß. Dieser Satz ist in Herrsching deshalb spannend, weil die St. Josefskongregation Ursberg für die berühmte Klosterwiese in Breitbrunn ein solches Modell plant.
In der Diskussion ging es um die Frage, wo denn Herrsching noch Grundstücke für genossenschaftliche Projekte bieten könne. Dass der Landkreis das irgendwann freiwerdende Schindlbeck-Grundstück versilbern werde, um einen Teil der neuen Klinik zu finanzieren, provozierte Nachfragen, welchen Einfluss die Gemeinde auf die Bebauung habe. Die Gemeinde habe über den Bebauungsplan die Planungshoheit, sagten die Gemeinderätin Gruber und der dritte Bürgermeister Schneider.
Tiefgaragen sind Umweltsünder
In Deutschland, da waren sich die Fachleute einig, ist Bauen auch wegen der vielen Normen und Vorschriften zu teuer. Ein Kostentreiber sind die Tiefgaragen, die von der gemeindlichen Stellplatzsatzung gefordert werden. Ein Beispiel für den wahnartigen Autostauraum führte Gemeinderätin Traudi Köhl an: Als sie ihr Haus mit der Familie ihrer Tochter teilte, hätte sie zusätzliche Stellplätze ausweisen müssen – die es aber nicht gebe. Da grätschte Gemeinderat Schneider dazwischen: „Die Stellplatzsatzung ist existentiell wichtig. Wer hat denn in Herrsching kein Auto?“ Wie wichtig Stellplätze seien, zeige sich am Friedhof, an dem oft keinen Parkplatz mehr zu finden sei. Stupka wies im Gegenzug darauf hin, dass jeder Tiefgaragenstellplatz 6 Tonnen CO2 verursache. In einem neuen Quartier in München seien die Planer von 8.800 motorisierten Fahrzeugbewegungen in das und aus dem Quartier täglich ausgegangen. Es waren nach vollständigem Bezug: 4.500
Gemeinderätin Christiane Gruber wollte wissen, ob man auch bei einer nicht ortsansäßigen Genossenschaft Herrschinger Bürger bei der Wohnungszuteilung priorisieren könne. Stupkas Antwort: Ja, das geht.
Als netten Gag streute Christian Stupka noch die Frage ein, woran man aus der Luft einen Wohnblock in privater Hand von einem Genossenschaftsbau unterscheiden könne. Ganz einfach: Bei einem Haus mit noblen Eigentumswohnungen throne ein protziges Penthouse auf dem Dach, bei einem Genossenschaftsbau breite sich eine bunte Gemeinschaftsterrasse in Toplage aus.



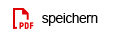





Thema Stellplätze für Autos…
Beim Spazierengehen in Breitbrunn und Herrsching fällt mir auf, dass oft das Auto vor dem Stellplatz der Eigenheime auf der Straße steht und den Fußgängern und Rädern im Wege steht. Um von den Autos nicht angefahren zu werden, weiche ich dann immer auf die Stellplätze beim Spaziergang aus. Gemeindestraßen mit Parkverbot sind deshalb jetzt meine bevorzugten Gehwege. Heidi Körner
Da ich in dieser Woche die Tulpenfelder in Holland mit dem Keukenhof besuchte, konmte ich an der Veranstaltung nicht teilnehmen. Schade. Gut, dass es Herrsching Online gibt und ich mich informieren kann. Heidi Körner Gartenbauverein Breitbrunn