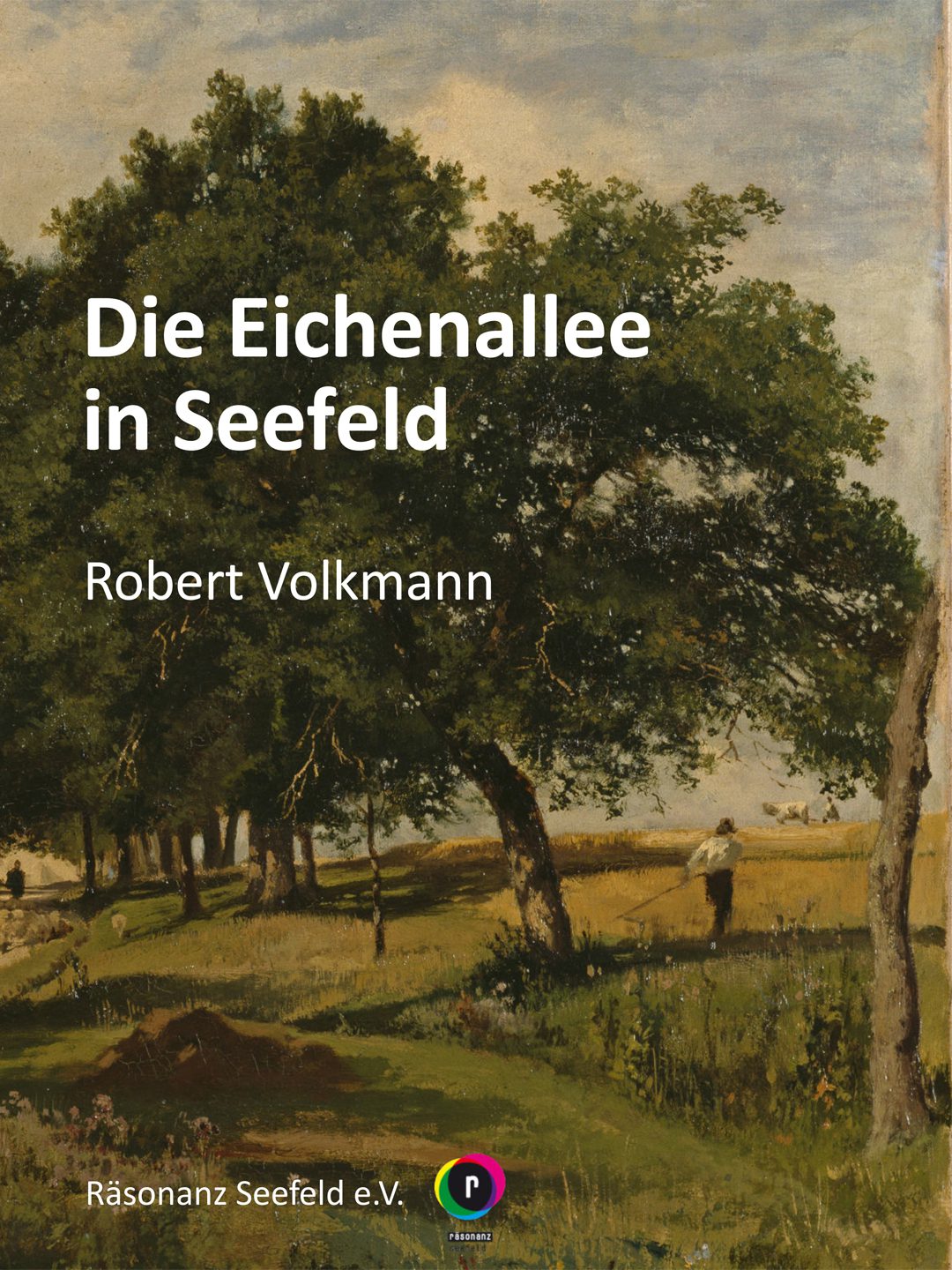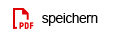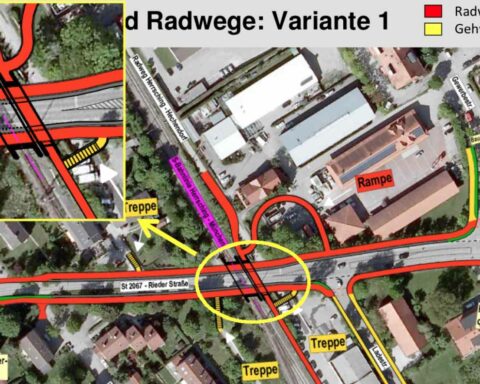Die Eichenalle von Gut Delling bis nach Seefeld wird als historisches Naturdenkmal bewundert. Und so feiern die Seefelder und Hechendorfer mit dem ganzen Landkreis das 250. Bestehen dieser „längsten und ältesten Eichenallee Europas“. Auch wenn der Heimat-Historiker Robert Volkmann in seiner historischen Festschrift solche Superlative in Zweifel zieht – am Sonntag ist alles, was Grün im Namen, im Herzen und in der Kleidung trägt, zwischen Gut Delling und Seefeld unterwegs. Die Autos, die größten Feinde des Naturdenkmals, sind dann ausgesperrt.
Auf dem Obelisken/der Pyramide im
Schlosspark zu Seefeld ist zu lesen:
„Was der Väter Fleiß gethan,/ erkennt mit Dank
der Enkel an!“ . Schön gesetzte Worte, sie
gefallen uns.
Der Starnberger Kreisheimatpfleger
Gerhard Schober schreibt in seinem
Prachtband über „Schlösser im Fünfseenland“:
”Das Alter der Eichenallee
Hier Auszüge aus der Schrift von Robert Volkmann (Schlagenhofen) mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers Räsonanz Seefeld e.V.
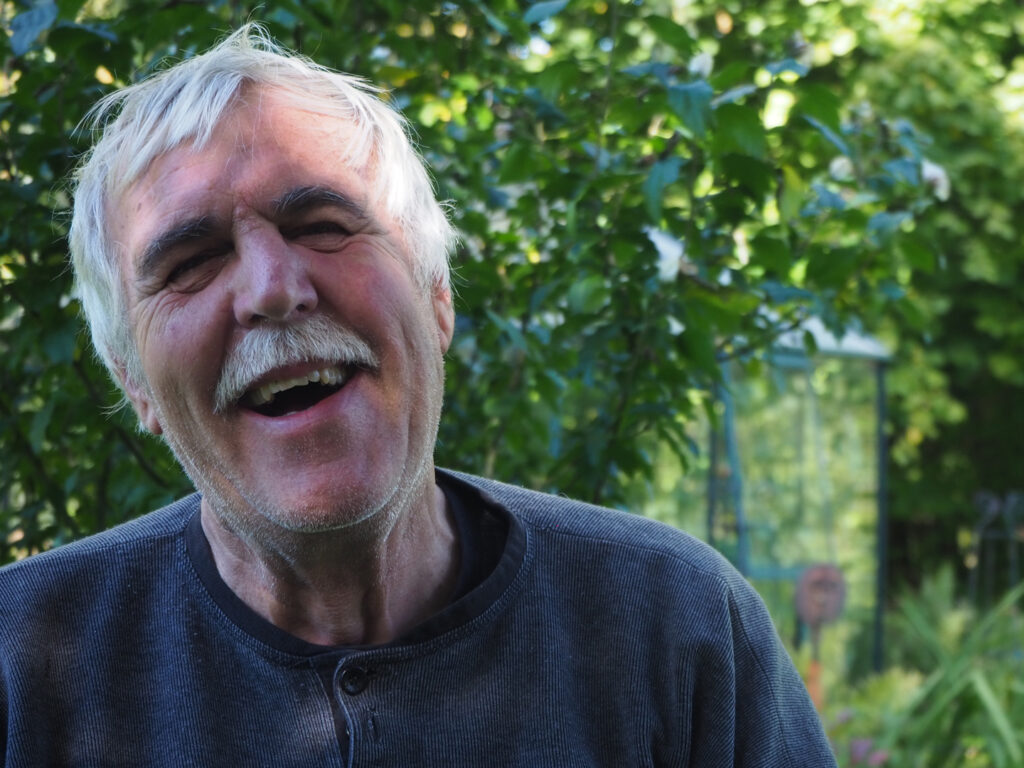
ist nicht eindeutig festzustellen, denn die
Quellen machen dazu keine Angaben. Da in
den älteren Quellen des 19, Jahrhunderts
stets Graf Anton Clemens als Urheber genannt
wird, wird es wohl nicht vor 1766 gewesen sein.
Die Zeitspanne 1770 bis 1780 dürfte realistisch
sein.”
Es wurde schon eine Menge gegrübelt,
warum der Graf diese Alleen hat angelegen
lassen.

Eine verbreitete These ist, dass der Graf die
Allee „inspiriert durch Reisen in das
alleenreiche Brandenburg“ hat pflanzen
lassen. Nach aktueller Auskunft der
Törring-Expertin Jolanda Englbrecht gibt
es keine Belege für Reisen des Grafen in
den Nordosten Deutschlands.
Vermutlich muss man mögliche Anregungen
gar nicht im Norden suchen. In den
Jahrhunderten vor Revolution und Säkularisation
wurden auch im Süden bei Adelssitzen
und Klöstern viele Alleen angelegt.
Diese sind hier allerdings den bewegten
Zeiten und den im Vergleich zum Land der
Junker weniger beharrlichen Herrschaftsverhältnissen
zum Opfer gefallen. Die Besonderheit
‚unserer‘ Eichenallee ist, dass
sie die unruhigen Zeiten überdauert hat.
Wir kennen nicht die konkreten Motive von
Graf Anton Clemens (des Stifters; Red.). Deshalb gehen wir
einfach mal davon aus, dass der gebildete
und weitläufig vernetzte Graf einem Verhaltensmodell
seiner aufgeklärten Zeit gefolgt
ist und etwas Schönes, Repräsentatives
mit Nutzen für Ökonomie und Verkehr
schaffen wollte.
Als Selbstverständlichkeit angenommen
und in allen entsprechenden Texten
verkündet wird das Lob des Erbauers, des
Grafen Anton Clemens von Törring–
Seefeld: „Die Eichenallee von Seefeld nach
Delling ist das bleibende Denkmal an diesen
großen Seefelder Grafen.“
1798 gründete er die „Seefeldische Ackerbaubausozietät“,
deren Ziel die deutliche Verbesserung der
landwirtschaftlichen Produktion und damit
auch der sozialen Situation der Bauern
war.
Das Forstamt der Seefelder Herrschaft
nutzte die Eichenallee auch zur ganz normalen
Holzgewinnung. Einmal scheint es
dem Grafen selbst zu viel geworden zu sein,
schreibt er doch seinen Forstleuten, sie
fällten zu viel: „In Zukunft hat das Fällen von Bäumen in
Parken, in Anlagen und Alleen nur nach
eingehaltener Genehmigung bei mir zu
geschehen. Aus der Dellinger Allee können für
heuer nur 30 St. Eichen geschlagen werden,
dagegen sollen größere Lücken durch Einsetzen
junger, kräftiger Eichen und Buchen dort
ausgefüllt werden.“
Umgekehrt schaute der Seefelder Förster
genau nach, ob noch alle Bäume standen.
Sicher fanden diese Eichen nicht als
Schäleichen für den Gerber von Oberalting
Verwendung.
Da müssen die Rinder schon arg hungrig gewesen sei, dass
sie zum bitteren Eichenlaub griffen. Weil´s
so schön passt: Der Hechendorfer Pfarrer
Heinrich Gietl klagt 1860, „wegen des zu
starken Laubscharrens und Weidschaften“
gebe es keine Naturverjüngung in den
Wäldern.
Wir kennen die Eichenallee als Verbindung
von Schloss Seefeld und Gut Delling.
Gedacht und gepflanzt wurden aber nacheinander
gleich mehrere Alleen. Fast sternförmig
sollten sie aus allen Himmelsrichtungen auf das Schloss von
Graf Anton Clemens hinführen. Und selbstverständlich
nimmt von dort aus alles seinen Ausgang. Hier zeigt sich nicht nur
Gestaltungswille, sondern auch
das Selbstbewusstsein spätabsolutistischer
Herrscherfamilien. Von ihnen geht alles
aus, zu ihnen kehrt alles wieder. In ganz
Mitteleuropa dachte (und pflanzte!) man
damals so.
Insgesamt gab es Alleen
– von Schloss Seefeld nach Gut Delling,
unsere ‚Eichenallee‘
– von Schloss Seefeld nach Güntering
(‚Gindering‘), eine Allee von Kastanien
und Pappeln. Letztere in alten Bildern
zu sehen
– abzweigend von der Eichenallee nach
Güntering zur Beermahd
– abzweigend von der Eichenallee zum
Ziegelstadel
– von Gut Delling zur Schwaige
Ettenhofen mit Eichen, später ergänzt
und verlängert mit Eschen
– von Gut Delling nach Westen als Eichenallee
in Richtung zur Schwaige
Schluifeld zum dortigen See.
Der Revierförster Merk verfasst eine ganze
Abhandlung „Beschreibung über
Entstehung der Straße und Eichenallee von
Seefeld nach Delling“ . Sie sei in Auszügen
wiedergegeben:
„Anno 1750 war damals, wo jetzt genannte
Straße ist, nur Moos und sünftige Wiesen, und
man musste um von Seefeld nach die
herrschaftliche Schwaige Delling zu fahren auf
einen Umweg, welcher sehr schadhaft war …
Der damalige hohe Gutsherr von Seefeld, Herr
Anton Graf von Törring Seefeld Excellenz, ein
ausgezeichneter Ökonom, kam auf den
Gedanken … und zwar aus folgenden Gründen:
1. Um in der Wiesenkultur einen Anfang zu
machen … und um den Leuten zu zeigen,
welchen großen Nutzen solche Kulturen
gewähren und 2tens um auf einen näheren und
besseren Weg nach Delling zu kommen.
Vier Jahre, von 1853 bis 1857, prozessieren
der Graf und die Kläger um ihre Ansprüche.
29 Die Kläger unter Führung des Johann
Kreuzmayer „Furtnerbauer zu Mailing“,
nehmen sich einen Münchner Anwalt, und
der schreibt kämpferische Briefe an die
Gerichte. Man stimmt einem ersten
Vergleichsvorschlag des Grafen nicht zu,
wonach man „sämtliche Eichen, welche die
Allee von Seefeld nach Dölling bilden“ als
Eigentum des Grafen anerkenne. Der
Anwalt der Kläger formuliert dazu: „Meine
Mandanten können den vom Herrn
beklagten gemachten Vergleichsvorschlag
nicht anerkennen und muß sonach die
Sache im Prozessweg zur Entscheidung
gelangen.“ Erstinstanzlich wird die Klage
schnell als „ungegründet“ abgewiesen. Die
Allee sei etwas künstlich Geschaffenes und
ihre Bäume könnten nicht als Bestandteile „der einzeln anliegenden Grundstücke
betrachtet werden“. Nun steht Ärger ins
Haus, offensichtlich werden Bäume gefällt,
es wird behauptet, man habe „seit
unvordenklicher Zeit“ das Nutzungsrecht
an den schadhaften Stämmen, an „Abholz“,
Laub und den Eicheln sowieso.
Was hier auf den ersten Blick wie kleinliche
Rechthaberei bis Boshaftigkeit aussehen
mag, hat einen realen Hintergrund: In
Bayern (und das gilt nachweislich auch für
unsere Gegend) herrscht wieder einmal
„Holznot“. Mit der sog. Bauernbefreiung
waren die allermeisten Bauern auch der
Holznutzungsrechte in den herrschaftlichen
Wäldern verlustig gegangen, man musste
für den Holzbezug zahlen. Kohle gab es
noch nicht, Torfabbau hatte gerade erst
begonnen und erbrachte nicht viel. Holz war unverzichtbares Heizmaterial. Wir können
ohne Übertreibung davon ausgehen,
dass es damals unter den Bäumen unserer
Allee mindestens so sauber astrein (im
Wortsinn) war wie unter den Bäumen von
heute.
Bäume als Verkehrsgefahr
Das zuständige Staatliche Bauamt in
Weilheim formuliert treffend: „Die Allee ist
ein lebendiges Denkmal im Spannungsfeld
zwischen Denkmalschutz, Naturschutz und
Verkehrssicherheit“.
Wie an jeder Schönheit nagt auch hier der
Zahn der Zeit. Bäume können sehr alt
werden, ewig leben auch sie nicht.
Wahrscheinlich gibt es auch hier eine
genetisch vorgegebene Lebenszeit gibt:
„Blitz, Sturm und Schädlingsplage sind
dann nur Erfüllungsgehilfen eines Todes,
der früher oder später ohnehin eintreten
muss, spätestens, wenn die maximale
Altersgrenze erreicht ist.“
Ende März 2004 befasste sich der Seefelder
Gemeinderat – wieder einmal – mit dem
leidigen Thema „Eichenallee“. Mehrheitlich
lehnte man die Fällung einiger und
generell älterer Bäume ab. Der zuständige
Kreisfachberater beim Landratsamt
musste amtlicherseits die mögliche Gefährdung
der Verkehrssicherheit zur Kenntnis
nehmen und die Bäume zur Fällung
freigeben. Gestützt hat man sich dabei auf
eine Stellungnahme eines vom
Straßenbauamt beauftragten unabhängigen
Gutachterbüros. Ursächlich begründet
wurde der Antrag durch den Gutachter mit
„erhebliche(n) Vitalitätsmängel(n)“,
geringer Lebenserwartung, „Vorschäden
durch Anfahrschäden“, verminderter
Standsicherheit, kurzum: „Solche Bäume
können unter Umständen innerhalb weniger
Jahre zu Gefahrenquellen werden.“
Das gefiel einigen im Gemeinderat nicht,
vom Straßenbauamt wurde ein Pflegekonzept
eingefordert, von diesem auch
vorgelegt. Das Ergebnis ist erschreckend:
„Insgesamt werden zirka 95 Bäume in den
nächsten 20 Jahren entnommen werden
müssen, was etwa einem Drittel des
Altbaumbestandes entspricht.“ Das durfte
nicht wahr sein“. Bürgermeister Wolfram
Gum beauftragte am 02.07.2004 in Namen
des Gemeinderates das Gutachterbüro von
Dr. Georges Lesnino mit einer gesonderten
fachlichen .berprüfung von 92 Bäumen
der Allee.
Ursächlich dafür sind neue Verordnungen
des Bundesverkehrsministeriums. 70 Da ist
ein nicht nur sprachliches Monstrum mit der
Bezeichnung ESA: „Empfehlungen zum
Schutz vor Unfällen mit Aufprall auf
Bäume“. Daneben gibt es noch die RPS:
„Richtlinie für passiven Schutz an Straßen
durch Fahrzeugrückhaltungssysteme“. In
praktischer Umsetzung: Überall dort, wo
ein Fahrzeug mit einem Alleebaum
kollidieren könnte, müsste man Metallleitplanken
verbauen! 71 Der Entwurf der
„Richtlinien zum Schutz vor Baumunfällen“
(RSB) empfahl, keine neuen Bäume mehr
dort nach zu pflanzen, wo mehr als 70 km/h.
gefahren werden dürfen. Deshalb ist in der
Eichenallee Tempo 70 festgelegt.
Es dürfen nach diesen Vorgaben sogar
Alleen neu gepflanzt werden – wenn ein
Abstand der Bäume von jeweils mindestens
sieben Metern zur Fahrbahn gewährleistet
ist. Inzwischen ist man allerdings auf einen
geringeren Abstand heruntergegangen.
Trotz des großen Abstandes und der weitgehend
geraden Linienführung kommt es
leider immer wieder zu tragischen Unfällen
meist junger Autofahrer. Einige Kreuze
erinnern daran. Die Bäume tragen keine
Schuld. In der Erzählung „Die springenden
Alleebäume“ heißt es bei Herbert
Rosendorfer: „Es ist Nacht. Gemütlich
tuckert ein Sportwagen mit 120 oder 140
km/h auf einer Landstraße dahin. Der
Fahrer dämmert, weil eine Fahrt auf einer
Landstraße langweilig ist, im Halbschlaf.
Der Alleebaum aber, der Alleebaum ist
hellwach. Genüsslich… alles deutet darauf
hin, dass es von ihm genüsslich ist, lässt der
Alleebaum den Wagen heran kommen, dann
… ein Sprung von nicht mehr als einem
Meter in die Fahrbahn des Wagens. Der
Mann am Steuer, der obendrein schläft,
kann natürlich nicht mehr ausweichen …
Der Alleebaum, dem ja in der Regel außer
ein paar Kratzern in der Rinde nichts
passieren kann, rauscht hämisch mit den
Blättern.“